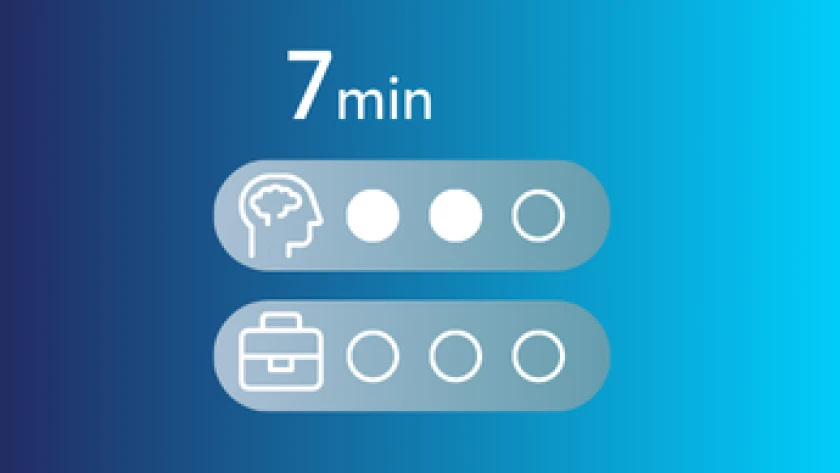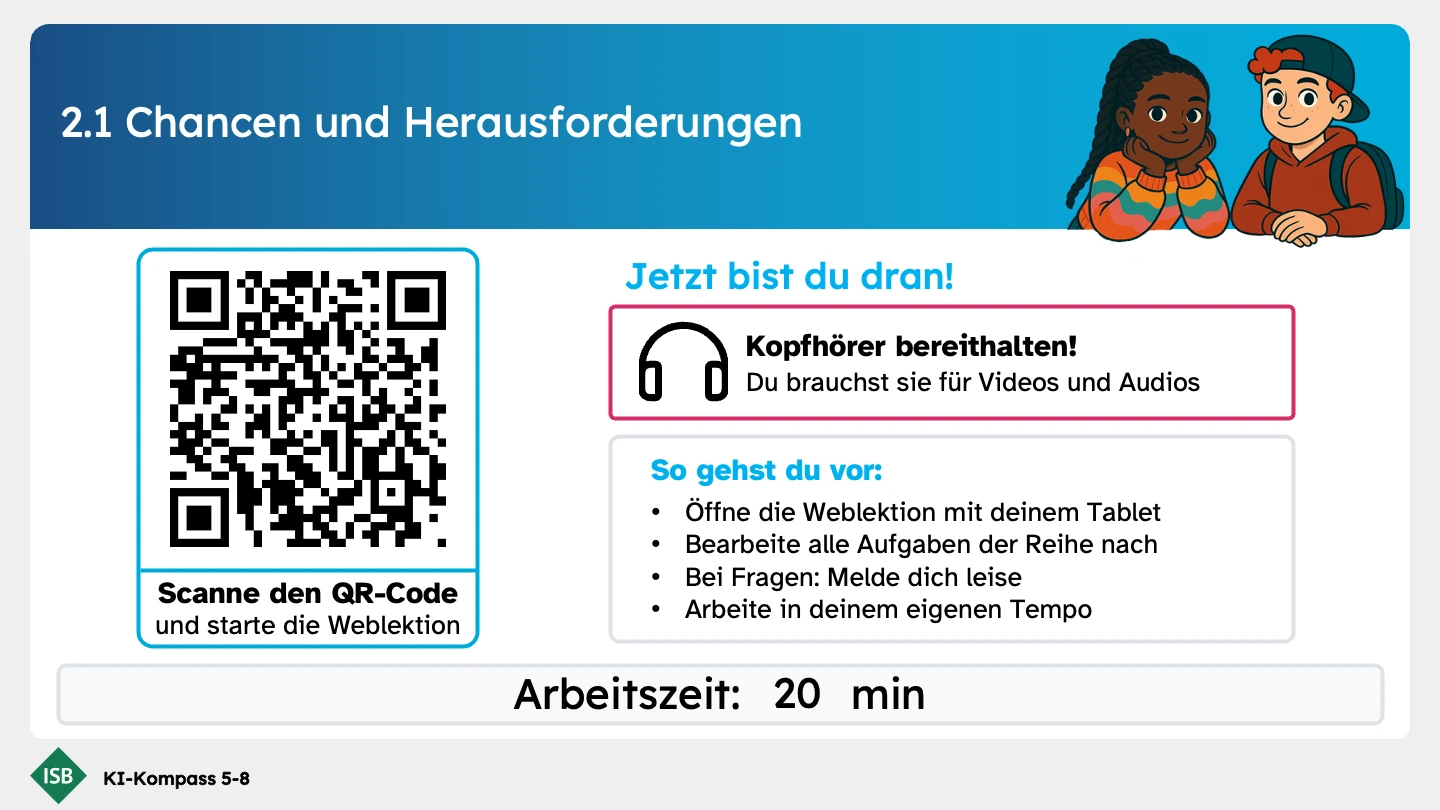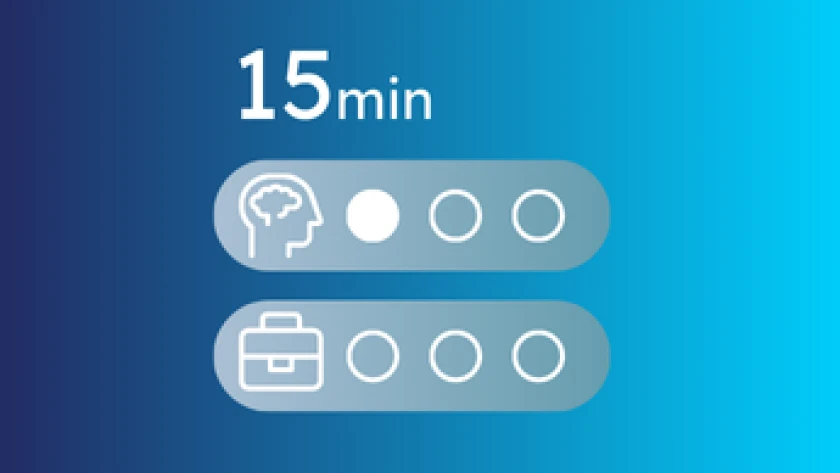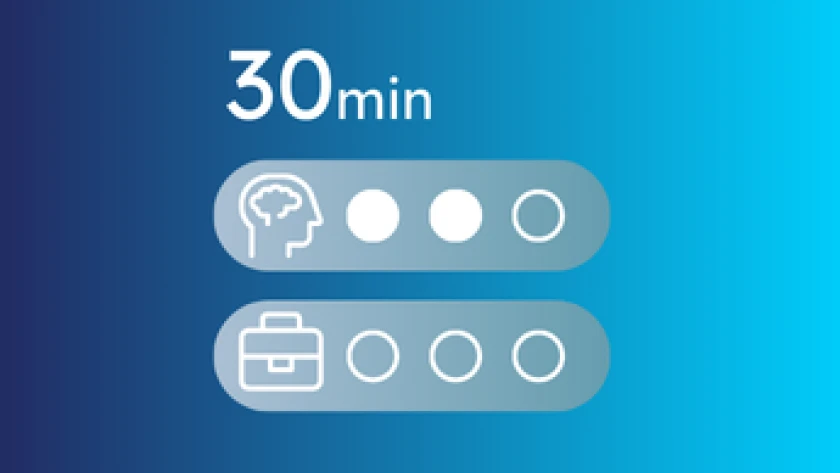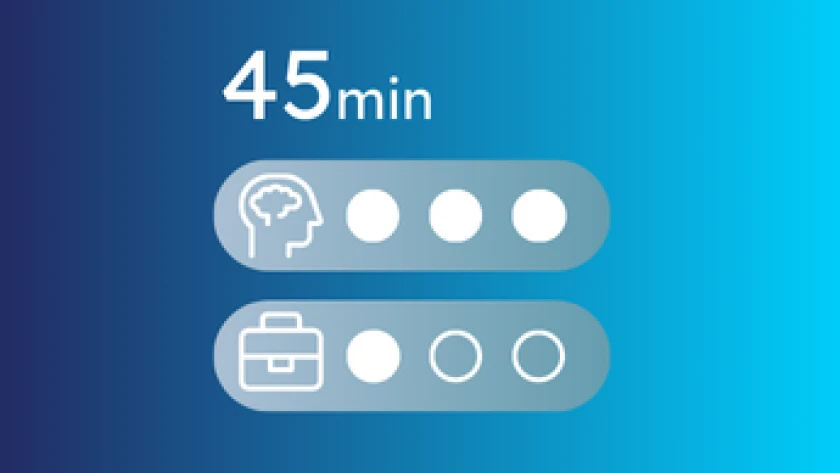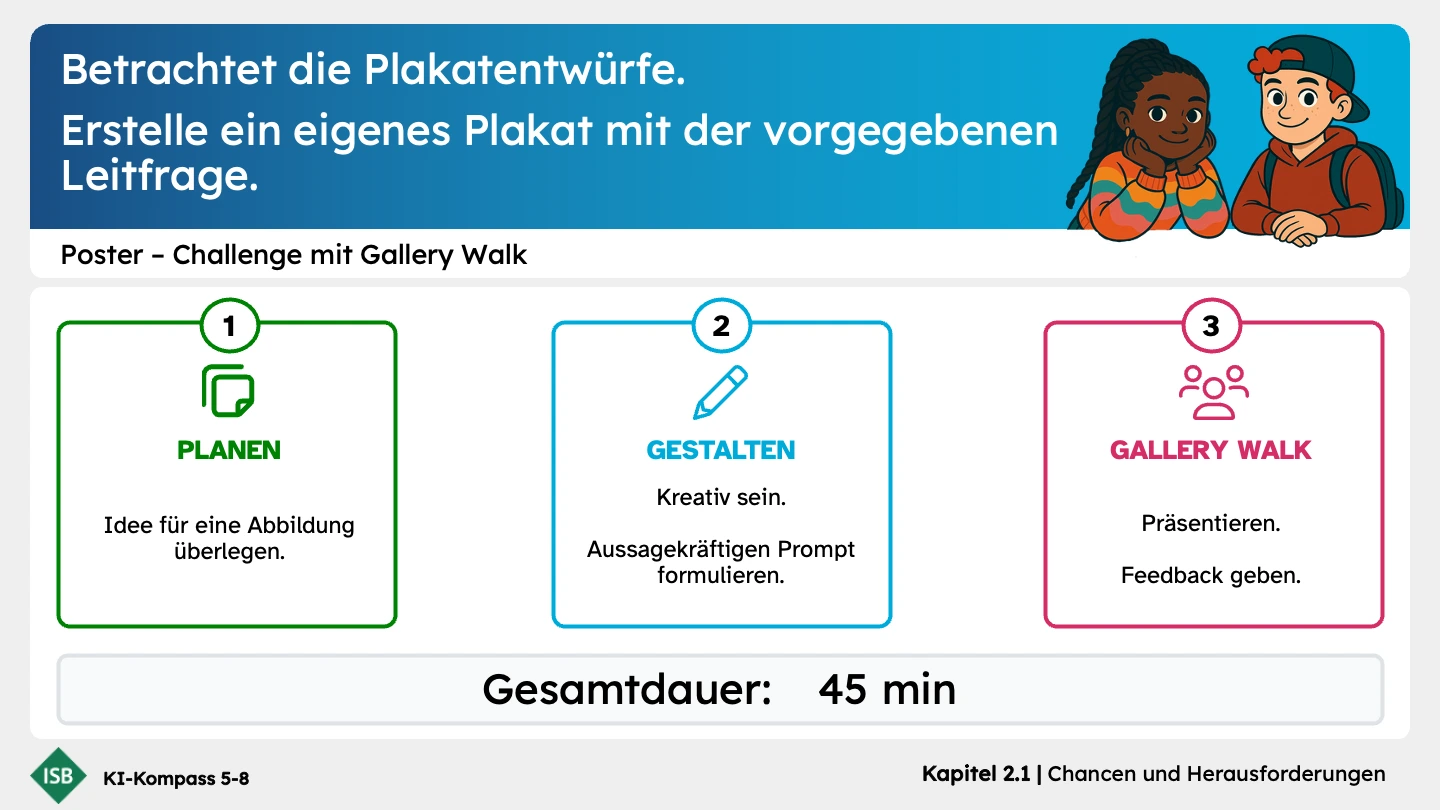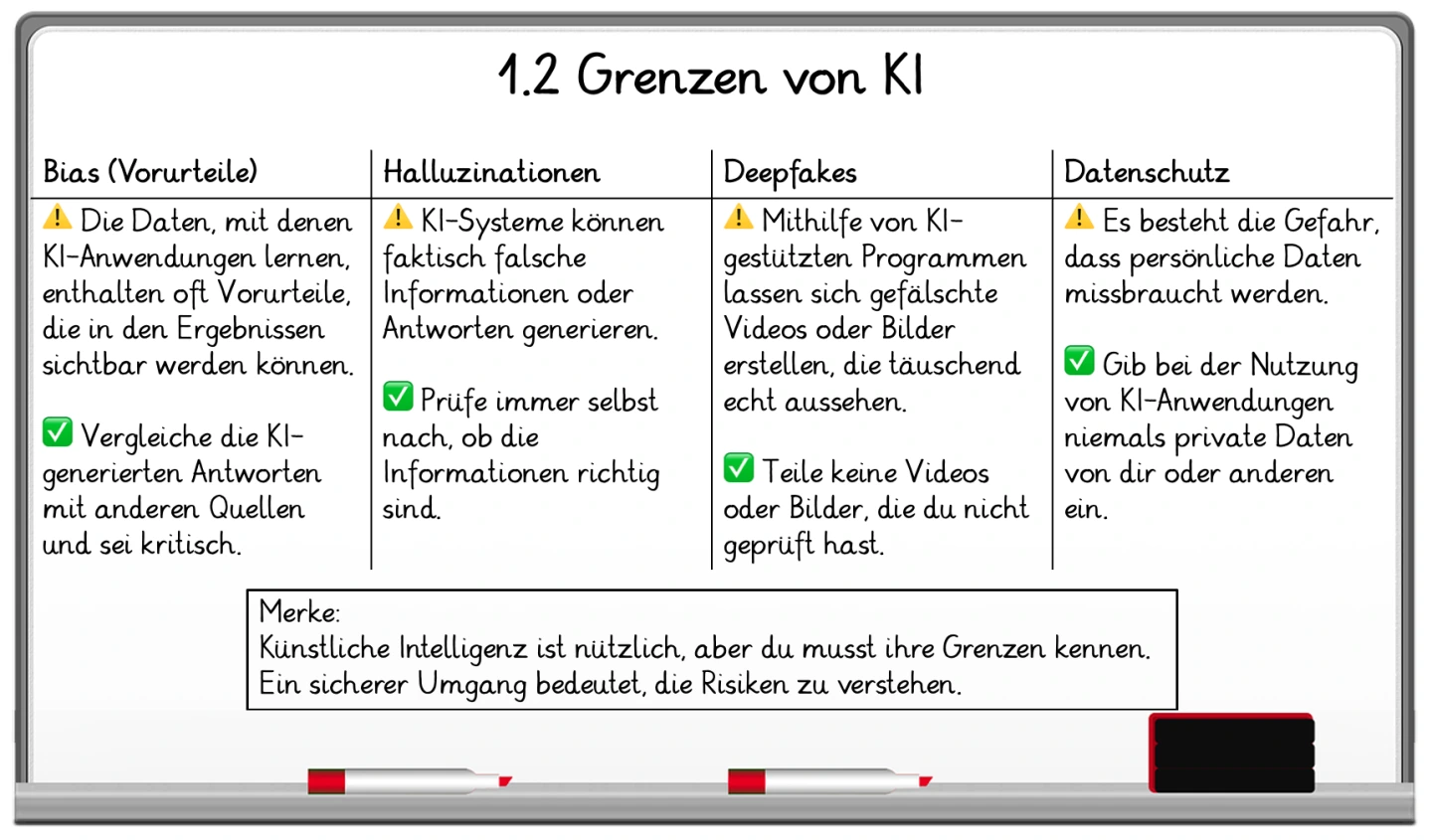Variante 1
Das Blitzlicht zeigt, wie gut Lernende darin sind, Bildfehler in KI-generierten Bildern zu erkennen. Die Methode fördert das Bewusstsein für unterschiedliche Betrachtungsweisen von Abbildungen und schärft die Wahrnehmung für das sichere Erkennen üblicher Bildfehler bei KI-generierten Bildern.