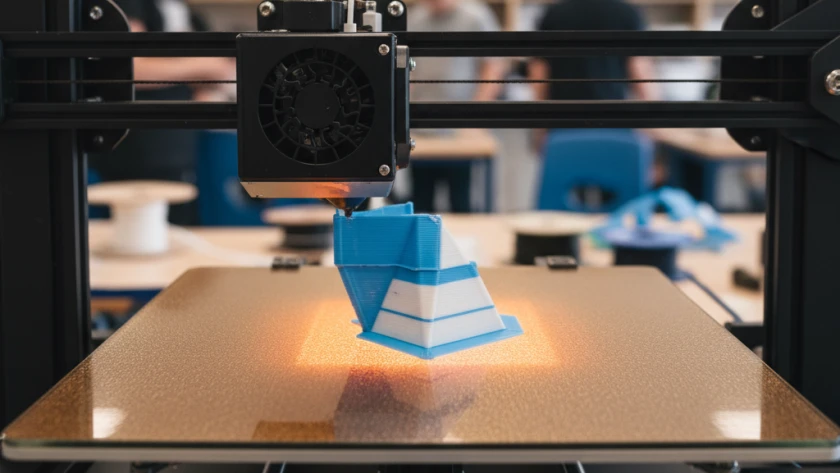Welche konkreten Empfehlungen würden Sie Schulen geben, um einen inklusiveren und gendersensibleren Informatikunterricht zu gestalten?
Meine Empfehlung ist mehr Lehrerinnen in der Informatik einzusetzen oder gezielt nahbare Role Models einzuladen, wie z. B. Informatikstudentinnen, die selbst erst im Bachelor-Studium sind, da diese sich besser mit Schülerinnen identifizieren können als Professorinnen oder Doktorandinnen. Sie können authentische Einblicke in das Informatikstudium geben und Fragen beantworten, die für Schülerinnen relevant sind, wie beispielsweise „wie kamst du dazu“, „was gefällt dir am Studium“ oder „wo gibt es Probleme“.
Das Nächste ist, die Lehrkräfte zu sensibilisieren, damit sie Mädchen in MINT-Fächern gezielt positives Feedback zu ihren Leistungen geben.
Und das Dritte ist, Themen zu wählen, die für alle Geschlechter interessant sind.
Worum es mir bei allem geht ist, dass die Mädchen ihre eigenen Neigungen und Begabungen wirklich entdecken können und sich nicht selbst den Weg durch eine verzerrte Selbstwahrnehmung verstellen.
Abschließend gilt unser Dank Frau Prof. Dr. Ute Schmid, die sich bereit erklärt hat, das Interview zu führen. Für ihre hilfreichen Anmerkungen möchten wir uns recht herzlich bedanken. Wir freuen uns darauf, von ihren Erfahrungen zu lernen und diese in der Praxis umzusetzen.