
Makerspace - Digitale Technologie
Makerspaces bringen Hightech und Kreativität direkt ins Klassenzimmer. Hier werden Schülerinnen und Schüler zu Erfinderinnen und Erfinden und gestalten mit 3D-Drucker, Lasercutter und VR ihre eigenen Projekte.
Ein Makerspace verwandelt Schulen in kreative Lernorte, an denen Ideen Wirklichkeit werden. Dieser Artikel zeigt, wie die Einrichtung eines Makerspaces gelingt – von der Auswahl passender Technologien über die Gestaltung inspirierender Räume bis hin zu ersten erfolgreichen Projekten. So entsteht ein Raum, der Innovation und Zusammenarbeit fördert.

Die Umsetzung eines Makerspaces an einer Schule erfordert eine sorgfältige Planung und geht einher mit einigen Herausforderungen. Jede Schule sollte ihre spezifischen Rahmenbedingungen wie räumliche Gegebenheiten, technische Ausstattung und das Engagement des Kollegiums, realistisch bewerten.
Die Wahl eines geeigneten Raums ist essenziell. Idealerweise sollte er mindestens 80 Quadratmeter groß sein und somit ausreichend Platz für eine Schulklasse bieten. Zudem sollte er in Bereiche für „Schmutzarbeiten“ (z. B. Holz- und Metallbearbeitung) und „saubere“ Arbeiten (z. B. Elektronik) aufgeteilt werden können. Außerdem benötigt der Raum eine ausreichende Anzahl von Stromanschlüssen, WLAN, Lüftungsmöglichkeiten und eventuell einen Wasseranschluss.
Für Schulen mit begrenztem Platz kann ein mobiler Makerspace oder ein kurzfristiger Makerspace mit Materialien, die ein Klassenzimmer bietet, eine flexible Lösung sein. Alternativ können sich auch benachbarte Schulen zusammentun und Räumlichkeiten mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen eines Makerspaces gemeinsam nutzen. In manchen Regionen betreiben auch Firmen oder Werkstätten kleine Makerspaces, die ggf. auch von Schulen genutzt werden können - fragen Sie einfach bei umliegenden Betrieben nach.
(#wirfürschule 2023; Kroker 2024)
Die Einrichtung eines Makerspaces kann, je nach Ausstattung und Umfang, hohe Kosten verursachen. Neben Werkzeugen und digitalen Geräten wie 3D-Druckern, Lasercuttern, etc. müssen auch Kosten für (Verbrauchs-)Materialien, Mobiliar und Wartung eingeplant werden.
Beginnen Sie mit einer Basis-Ausstattung (Variante "Light“) und erweitern Sie den Makerspace schrittweise. Setzen Sie sich einen Schwerpunkt zu Beginn der Arbeit. Kooperieren Sie mit lokalen bzw. umliegenden Unternehmen oder Eltern, um zusätzliche Ressourcen zu gewinnen.
Klären Sie zudem, aus welchen „Töpfen” die Schule die Verbrauchsmaterialien (z. B. 3D-Drucker-Filament, Holz für Lasercutter) und anfallende Reparaturen bezahlt. Beziehen Sie hierzu ggf. auch den Sachaufwands- bzw. Schulträger in die Planungsgespräche mit ein.
Die Planung, Einrichtung und spätere Betreuung des Makerspaces erfordert erhebliche personelle Kapazitäten. Besonders im Schulalltag kann es schwierig sein, dafür ausreichend Zeit und Personal zu finden.
Bilden Sie ein engagiertes Team, das die Verantwortung teilt und regeln Sie die Verantwortlichkeiten klar. Setzen Sie auf einfache, wartungsarme Geräte, die leicht zugänglich sind, um eventuell anfallende Reparaturkosten durch falsche Bedienung zu vermeiden. Denken Sie daran, dass Makerspaces hauptsächlich durch Schülerinnen und Schüler eigenständig verwendet werden.
Beachten Sie bei der Ausstattung und Planung des Makerspaces sowie beim Kauf des technischen Equipments auf die Einhaltung der geltenden Sicherheitsrichtlinien. Ein günstiges Gerät aus dem Supermarkt (= Consumer-Gerät) erfüllt möglicherweise nicht die durch die Kultusministerkonferenz vorgeschriebenen Bestimmungen (vgl. KMK, 2023).
Greifen Sie bei der Einrichtung eines Makerspaces und dem Kauf der Geräte auf die Expertise einschlägiger Schulausstatter zurück. Diese beraten Sie vor Ort und erstellen einen Plan, wie Sie am besten ihren Makerspace umsetzen können. Zudem bieten die Firmen oftmals auch Schulungen an den einzelnen Geräten an.
Lehrkräfte müssen nicht nur mit der Technik, sondern auch mit den pädagogischen Prinzipien des Makings vertraut sein. Dies erfordert Weiterbildungen, immerwährende Fortbildung und eine Veränderung der Rolle vom Lehrenden hin zur Mentorin oder zum Mentor.
Beginnen Sie mit internen Workshops (schulinternen Fortbildungen) und besuchen Sie bestehende Makerspaces in Medienzentren, BayernLabs oder an anderen Schulen. Tauschen Sie sich dort mit dem betreuenden Personal und den Lehrkräften aus, um Inspiration und praktische Erfahrungen zu sammeln. Tauchen Sie einfach selbst in die Welt des Makings ein und nutzen Sie die angebotenen Möglichkeiten.
Ein weiterer kritischer Punkt ist die sinnvolle Verknüpfung des Makerspaces mit den Inhalten des Lehrplans bzw. die reibungslose Einbindung der Maker-Idee in den Fachunterricht. Es müssen Zeitfenster geschaffen werden, die ausreichend Raum für kreative Prozesse bieten.
Entwickeln Sie ein flexibles Nutzungskonzept, das projektbasiertes, problemlösendes Lernen in mehreren Fächern ermöglicht. Projektwochen oder Wahlfächer eignen sich besonders gut, um den Makerspace in den Schulalltag zu integrieren.
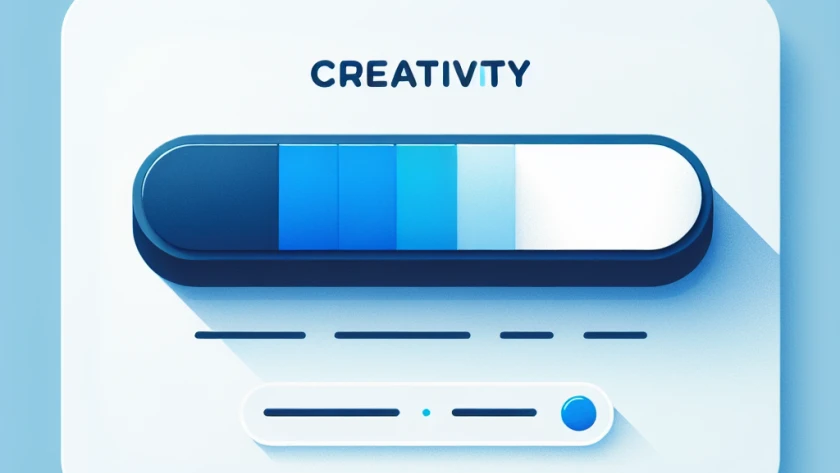
Nutzen Sie zunächst vorhandene Räume, Werkzeuge und Materialien. Ein einfacher Einstieg kann mit mobilen Makerspaces erfolgen, die flexibel in verschiedenen Klassenräumen eingesetzt werden können.

Beginnen Sie mit kleinen Projekten, um erste Erfahrungen zu sammeln und Lernende sowie Lehrkräfte schrittweise an die Arbeit im Makerspace heranzuführen.

Binden Sie lokale Partner wie Handwerksbetriebe, Universitäten oder Bibliotheken ein, um Unterstützung bei der Ausstattung oder Expertise zu erhalten.

Schulen sollten frühzeitig eine offene, kreative Lernkultur etablieren, die den Wert von Experimentieren und Fehlern als Lernprozess betont.
Ein Makerspace kann mit der richtigen Planung und einem schrittweisen Vorgehen zu einem inspirierenden Lernort werden, der Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte gleichermaßen begeistert und die Schule auf die Zukunft vorbereitet.
Makerspaces in Schulen
Digitale Technologien im Makerspace - Von 3D-Druck bis Virtual Reality
Makerspace und Inklusion
Die Zukunft der Makerspaces - Trends und Perspektiven
Makerspaces und Bewertung

Makerspaces bringen Hightech und Kreativität direkt ins Klassenzimmer. Hier werden Schülerinnen und Schüler zu Erfinderinnen und Erfinden und gestalten mit 3D-Drucker, Lasercutter und VR ihre eigenen Projekte.

Hier finden Sie pädagogische und technische Grundlagen zum Thema Robotik im Unterricht.

Hier bekommen Sie Anregungen, wie Sie das Erreichen von Entwicklungszielen an ihrer Schule wirksam inner- und außerschulisch kommunizieren können.

Makerspaces machen Schule kreativ – und stellen Lehrkräfte vor neue Herausforderungen. Erfahren Sie hier, wie sich die Rolle der Lehrperson im Makerspace verändert und welche Kompetenzen jetzt gefragt sind.

Der „Linienfolger” ist eine Art Standardaufgabe im Robotikunterricht. Erfahren Sie an diesem Beispiel, wie man Robotik im Unterricht gestalten kann.

Robotik im Unterricht: Eine spannende Möglichkeit zur Förderung von Schülerinnen und Schülern. Im Artikel finden Sie ausgewählte Unterrichtsbeispiele.