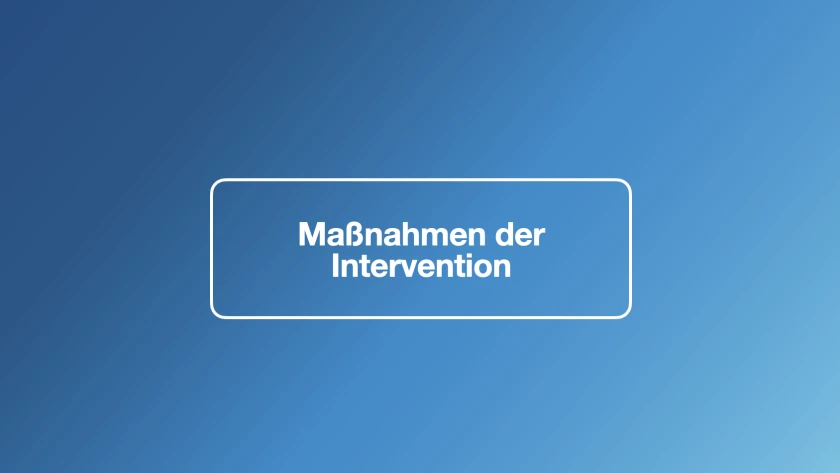Maßnahmen zur Reflexion
Lernende sollen durch die verbesserte Ausstattung befähigt werden, sich aktiv in der digitalen Welt auszudrücken und daran teilzuhaben. Dabei sollte ihre Partizipation jedoch bewusst und reflektiert erfolgen. Im Unterricht ergeben sich zahlreiche Anlässe, diese Teilhabe zu reflektieren, sowohl fachintegrativ als auch fächerübergreifend. Ziel ist es hierbei, dass die Lernenden ihre bisherigen Erfahrungen und das dazugewonnene Wissen über Medien verknüpfen.
Welche neuen Ansatzpunkte entstehen in der veränderten Ausstattung?
Integration in das Einarbeitungskonzept
Medienerziehung als fester Bestandteil des Classroom Managements
Integration in den Fachunterricht als Bestandteil des Unterrichtsalltags
Maßnahmen im Verlauf des Schuljahres außerhalb des Fachunterrichts
1 Integration in das Einarbeitungskonzept
Unmittelbar nach der Geräteausgabe ist eine Einarbeitungsphase für die Schülerinnen und Schüler unabdingbar, um einen reibungslosen Einstieg in das 1:1-Setting zu garantieren. Auch dieses Einarbeitungskonzept muss rechtzeitig erstellt werden.
Dabei müssen auch medienerzieherische Inhalte in das Einarbeitungskonzept für Lernende integriert werden. Die Einarbeitung in die neue Ausstattung der Schülerinnen und Schüler ermöglicht, auf verschiedene Aspekte der Medienerziehung einzugehen. Sowohl Einführungen in technische Bereiche als auch die Bekanntgabe von Regeln können genutzt werden, um die Lernenden in die Hintergründe des Regelkatalogs einzubinden und an wichtige Punkte der Medienerziehung anzuknüpfen.
Folgende Inhalte des Einarbeitungskonzeptes ermöglichen reflexive Medienerziehung:
Reflexion allgemein
Grundsätzlich sollen Regelbesprechungen regelmäßig, klassenübergreifend und altersgerecht stattfinden
Nutzung der Kamera
Rechtliche Hinweise: Straftaten
Medienerzieherische Hinweise: Recht am eigenen Bild, Datenschutz, Privatsphäre
Kommunikationswege und Arten
Medienerzieherische Hinweise: Netiquette bei sämtlichen Kommunikationswegen
Passwortmanagement
Medienerzieherischer Hinweis: Privatsphäre, Schutz und Sicherheit
2 Medienerziehung als fester Bestandteil des Classroom Managements
Die Unterrichtssituation im 1:1-Setting geht mit neuen medienerzieherischen Herausforderungen für jede Lehrkraft einher. Um diese bewältigen können, sollten sie ein fester Bestandteil des Classroom Managements sein. Grundsätzlich sollten Lehrende die Einhaltung von der Schule festgelegten Regeln einfordern, aber Regelverstöße auch als Lernanlässe sehen. Dabei gilt es, bei den Lernenden das Bewusstsein zu schaffen, einfache Verstöße klar von der Verletzung von Persönlichkeitsrechten unterscheiden und damit umgehen zu können. Mit der Unterrichtsplanung als auch medienerzieherischen Vorbereitungen im Vorfeld kann es der Lehrkraft gelingen, den Lernenden Vertrauen zu geben, aber auch auf Missachtungen adäquat zu reagieren. Als Voraussetzung für ein rücksichtsvolles Verhalten im Unterricht mit digitalen Medien sind somit Absprachen und Unterstützung unabdingbar.
3 Integration in den Fachunterricht als Bestandteil des Unterrichtsalltags
Fachliche Integration
Die Fachlehrpläne bieten vielfältige Möglichkeiten, medienerzieherische Aspekte in den Unterricht zu integrieren. Dies kann geschehen durch den vielfältigen Einsatz von handlungs- und produktionsorientierten Lernformaten, in denen u.a. Jugendliche die Rolle als Prosumenten (Produzenten und Konsumenten) beanspruchen. Dies führt auch zu einer Verknüpfung von Medien- und fachlichem Kompetenzerwerb. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Erweiterung des Nutzungsverhaltens und hier die Möglichkeiten, orts- und zeitunabhängig zu lernen, sich zu organisieren und kollaborativ zu arbeiten.
Auf diesem Weg können im Rahmen der regulären Unterrichtszeit Fach- und Medienkompetenzen in Verbindung gebracht werden und somit zu einer noch komplexeren Lernleistung führen. Konkret kann die Reflexion von Medien bzw. Mediennutzung in folgenden Bereichen thematisiert werden, die dem Kompetenzrahmen zur Medienbildung entnommen sind:
Beispielslider
Basiskompetenzen:
Das Lernen mit dem Tablet ist gleichermaßen individuell zu verstehen wie das Lernen mit analogen Arbeitsmitteln. Das Ziel im Rahmen der 1:1-Ausstattung ist es, dass die Lernenden sich ihre digitale Lernumgebung so einrichten und strukturieren, wie es für das persönliche Lernen am sinnvollsten erscheint. Strukturierungsvorschläge seitens der Lehrkraft und ein regelmäßiger Austausch darüber sollen helfen, eine lernförderliche Struktur auf dem Tablet zu schaffen. Indem die Lehrkraft kontinuierlich Feedback dazu gibt, erlangen die Lernenden ein erweitertes Verständnis für effektives Nutzungsverhalten und können dies besser reflektieren.
Suchen und Verarbeiten:
Der Erstellung von Referaten oder Produkten wie Lernkarten geht grundsätzlich eine Recherche voraus. Für Lernsettings wie WebQuests sowie Debatten im Deutschunterricht betreiben Lernende ebenfalls Internetrecherche. Hilfestellungen für die angeleitete und selbstständige Recherche sind nötig, um die Kompetenz „Suchen und Verarbeiten“ zu verinnerlichen. Nur, indem die Lernenden angeleitet werden, das Informationsangebot moderner Medien kritisch zu betrachten und zu bewerten, können sie zu einer differenzierten Haltung zum Informationsgehalt von Medien und deren Wahrheit gelangen.
Kollaboration und Kommunikation:
Das 1:1-Setting eröffnet im Unterrichtsalltag neue Wege der Kollaboration. Schülerinnen und Schüler werden in die Lage versetzt, ihre Arbeitsergebnisse digital zu veröffentlichen, sich zeit- und ortsunabhängig mit Lernpartnern auszutauschen sowie Ergebnisse unkompliziert zu überarbeiten und zu sichern. Zudem ergeben sich im Rahmen von Unterrichtsprojekten vielfältige Möglichkeiten des digitalen Datenaustausches und variable Kommunikationswege. Bei der Zusammenarbeit von Lernenden und Lehrenden erhält der Umgang mit Werkzeugen der Kommunikation immer mehr Bedeutung. Deshalb sollte zunächst eine Einarbeitung in die verwendeten kommunikativen Werkzeuge sowie eine Erarbeitung von Kommunikationsregeln erfolgen. Indem bei den Lernenden eine vergleichende und kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Mediennutzung angebahnt wird, lernen sie die Kommunikation anderer kennen und verstehen als auch einen sorgfältigen Umgang mit der Sprache in diversen Tools oder Apps zu reflektieren. Dies kann beispielsweise online als Austausch oder in Form von Peer-to-Peer Feedback stattfinden.
Produzieren und Präsentieren:
Die Erstellung von Medienprodukten wie Lernvideos, Audiodateien, interaktiven Mindmaps oder digitalen Präsentationen wird fachübergreifend praktiziert. Denkbar sind auch Social-Media-Beiträge in Deutsch oder in den Fremdsprachen. Sobald derartige Produkte erstellt und im Anschluss gar veröffentlicht werden, sind Urheberrechts- und Datenschutzaspekte zu beachten. Im Zusammenhang mit derartigen Unterrichtsinhalten sollten Inhalte zu den Themen wie Informationsrecherche, Quellenangabe, Privatsphäre, Urheberrecht, Datenschutz und Konsumentenentscheidungen grundsätzlich gelehrt und verinnerlicht werden.
Analysieren und Reflektieren:
Sowohl bei der Erstellung von Werbeplakaten als auch der Analyse bereits existierenden Materials können Schülerinnen und Schüler medienerzieherische Inhalte reflektieren. Hierbei spielen Konsumentenentscheidungen, Wirkung, Gestaltungsmittel und technische Umsetzung von Medien eine große Rolle. Durch kritisches Hinterfragen überprüfen die Lernenden Medien, um deren Wahrheitsgehalt zu erkennen. Folglich erfahren sie, welche Mittel Herstellende zur Einflussnahme und gegebenenfalls Manipulation verwenden. Hierbei gilt es auch das Bewusstsein zu schärfen, dass bei der Darstellung von Medieninhalten, z. B. Statistiken und Diagrammen, bereits eine Selektion erfolgte. Hierzu stehen folgende fertige Unterrichtsbausteine zur Verfügung:
Module des Medienführerscheins Bayern:
Einheit: Ich als Urheber – Urheberrechte erkennen und reflektieren
Einheit: Musik ohne Grenzen? – Grundlagen des Urheberrechts kennen und anwenden
Einheit: Ich im Netz I – Eigene Daten schützen und mit Bildern verantwortungsvoll umgehen
Einheit: Ich im Netz III – Rechtliche Grundlagen kennen und reflektieren
Einheit: Produkt sucht Käufer: Werbung analysieren – Konsum reflektieren
Sammlung im mebis Magazin
Urheberrecht | Recht am eigenen Bild: Ideen, Konzepte und Anschauungsmaterial, um mit Ihren Schülerinnen und Schülern die Grundlagen des Urheberrechts, des Rechts am eigenen Bild sowie der Nutzungsrechte in der Medienproduktion zu erarbeiten.
Die Vermittlung der Medienkompetenz findet nicht isoliert, sondern immer in einem ganzheitlichen pädagogischen Kontext statt. So werden gleichzeitig immer auch andere Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder und Jugendlichen angesprochen und erweitert. Folglich kann jedes Unterrichtsfach aus der jeweiligen Fachperspektive einen Beitrag zur Medienkompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler leisten.
All diese Bausteine sollten auch im Medien- und Methodencurriculum der Schule verankert werden, damit Zuständigkeiten verbindlich festgelegt sind. Die Kompetenzen der Lernenden sind dabei über die Jahrgangsstufen hinweg gezielt zu trainieren.
Pädagogische Integration
Lernende sollen dazu befähigt werden, sich aktiv in der digitalen Welt auszudrücken und daran teilzuhaben. Dabei sollte ihre Partizipation jedoch bewusst und reflektiert erfolgen. Im Unterricht ergeben sich zahlreiche Anlässe, diese Teilhabe zu reflektieren, sowohl fachintegrativ als auch fächerübergreifend. Ziel ist es hierbei, dass die Lernenden ihre bisherigen Erfahrungen und das dazugewonnene Wissen über Medien verknüpfen.
Die kontinuierliche Reflexion des Nutzungsverhaltens sollte hier als Chance begriffen werden, Störungen und Regelverstöße als Lernanlässe zu sehen und in diesem Sinne die Lehrkräfte auf die veränderten Anforderungen in der Klassenführung vorzubereiten.
Darüber hinaus ist eine systematische Reflexion der Mediennutzung essenziell, um die Kinder und Jugendlichen für die Chancen und Risiken der digitalen Welt zu sensibilisieren.
Die Lernenden sollen befähigt werden, sich aktiv in der digitalen Welt auszudrücken und daran teilzuhaben. Ihre Partizipation sollte jedoch bewusst und reflektiert erfolgen. Dabei verknüpfen sie ihre bisherigen Erfahrungen und das dazugewonnene Wissen über Medien. Im Unterricht ergeben sich zahlreiche Anlässe, die Teilhabe zu reflektieren.
Beispiele für medienpädagogische Reflexionen, die sich permanent im Unterricht ergeben:
Vergabe von Passwörtern beim Einrichten der Geräte oder von Zugängen: „Sind meine Passwörter sicher genug?“
Nutzung schulischer Kommunikationskanäle: Chat, E-Mail usw.: „Wie möchte ich behandelt werden?“ (Stichwort „Netiquette“)
Einsatz der Kamera zu unterrichtlichen Zwecken: „Beachte ich das Recht am eigenen Bild der anderen und wird auch meines beachtet?“
Erstellung und Bereitstellung erster eigener Medienprodukte: „Habe ich das Urheberrecht beachtet?“
Erweiterung des Nutzungsverhalten: orts- und zeitunabhängig lernen, sich eigenständig organisieren, kollaborativ arbeiten: „Hat sich mein Lernverhalten mit dem Tablet verbessert und wie kann ich es noch weiter verbessern?“
…
Gerade im Förderschulbereich ist das wiederholte Aufgreifen dieser medienpädagogischen Themen notwendig, um entsprechende Verhaltensweisen einzuüben und mehr Sicherheit in den einzelnen Themenfeldern zu gewinnen.
4 Maßnahmen im Verlauf des Schuljahres außerhalb des Fachunterrichts
Integration der Bausteine in das Vertretungskonzept
Integration der Bausteine in schulspezifische Zeitfenster
Einbindung und Etablierung von Peer-to-Peer-Konzepten
Gezielte Einrichtung von Veranstaltungen und Unterrichtseinheiten zum Thema „Medienerziehung“
1 Vertretungsstunden
Vertretungsstunden können in der verbeserten Ausstattung unkompliziert genutzt werden, um medienerzieherische Inhalte zu verankern. Organisiert man deren Vermittlung über das Vertretungskonzept haben Lehrende und Lernende dadurch auch jederzeit einen Überblick, welche Thematiken bereits durchgenommen wurden. Die Erarbeitung der entsprechenden Bausteine in einer Vertretungsstunde gewährleistet, dass das erworbene Wissen sofort praktische Anwendung findet und die Lernenden zu medienkompetentem Handeln angeleitet werden. Diesbezüglich ist es ratsam, eine Datenbank oder einen Kurs anzulegen, auf den alle Lehrkräfte Zugriff haben. Zudem sollten für Vertretungseinheiten die Stunden in kompaktem Umfang angelegt werden. Die Module vom Medienführerschein Bayern bieten Vorlagen mit einem Umfang von 45 oder 90 Minuten.
Umsetzungsbeispiele:
Identitätsfindung:
Fragen zu Schönheitsidealen, Geschlechterrollen oder Gesundheit, vorbereitet durch die Fachschaften Religion, Ethik oder Ernährung & Gesundheit, können in Vertretungsstunden sehr gut thematisiert werden.
Erstellung eines eBooks mit persönlichen Bildern einer Klasse:
Wenn eine Klasse ein digitales Buch erstellen soll, bedarf es einer reflexiven Medienerziehung bezüglich der dafür benötigten Medien (hier: Bilder und Fotos). Folglich ist es denkbar, dass die Lehrkraft den Auftrag erstellt, dass die Lernenden in der nächsten Vertretungsstunde die entsprechende Einheit in dem dazu angelegten (mebis-) Kurs erledigen sollen, um die nötigen Kenntnisse bei der Erstellung des Medienprodukts zu erlangen und zu beachten.
Ein solches Vertretungskonzept hätte also zwei große Vorteile: Die Vertretungsstunden wären mit sinnvollen Inhalten gefüllt und die beteiligten Lehrkräfte wären von der Bereitstellung von Materialien für die Vertretungsstunden entlastet.
2 Organisatorische Integration
An vielen Schulen gibt es in der wöchentlichen Stundentafel ein spezielles Zeitfenster für Angelegenheiten der Klassenleitung/Klassenleiterstunden. Oder es gibt bereits andere wöchentliche Aktivitäten zu festgelegten Zeiten, die zum Austausch in der Klasse dienen, wie z.B. Klassenkonferenzen, Feedback-Runden oder der Stuhlkreis am Montagmorgen.
Alle diese Aktivitäten ermöglichen es ebenfalls, mit Lernenden ihr Medienverhalten zu reflektieren. Gerade klassenaktuelle Themen der Mediennutzung können hierbei als Anlässe dienen.
Hier wäre es wichtig, ein feste Zeitfenster für entsprechende Aktivitäten einzuplanen, um die medienpädagogische Arbeit auf diese Weise auch fest im wöchentlichen Unterrichtsgeschehen zu verankern.
3 Etablierung von Peer-to-Peer-Konzepten
Es ist wahrscheinlich eine „Binsenweisheit“, dass vor allem jugendliche Schülerinnen und Schüler sich im Zweifelsfall vielleicht lieber Gleichaltrigen anvertrauen, als gleich den Weg zu einem Erwachsenen zu suchen.
Deswegen kann es sehr hilfreich sein, an der Schule ein entsprechendes Peer-to-Peer-Konzept, also z. B. „Medientutoren“ oder „Medienscouts“, für medienpädagogische Fragestellungen zu etablieren.
An dieser Stelle muss allerdings angemerkt werden, dass diese Medientutoren natürlich nur bei niederschwelligen Problemen Unterstützung geben können und bei ernsteren Problemen nur als erste Anlaufstation dienen können. Bei der Etablierung solcher Konzepte kann man auch auf externe Anbieter zurückgreifen. An dieser Stelle lassen sich z. B. die Projekte „Netzgänger“ oder „Medienscouts“ der Opferhilfe Oberfranken erwähnen.
4 Medienpädagogische Veranstaltungen
Im Lauf des Schuljahrs könnten auch klassen- und jahrgangsstufenübergreifende Medienprojekttage stattfinden. Diese könnten von der Schule selbst organisiert werden.
Aber man könnte hier auch die Angebote externer Anbieter nutzen. Ein gutes Beispiel wäre hier der „Safer Internet Day“. Auch die Zeitungsverlage und öffentlich-rechtlichen Sender bieten immer wieder entsprechende Aktionstage an.
Aber auch bereits etablierte regelmäßige Veranstaltungen wie Weihnachtsfeiern, Schul- oder Abschlussfeste könnten als Plattform für medienpädagogische Inhalte genutzt werden, z.B. durch das Erstellen von eigenen Medienbeiträgen.