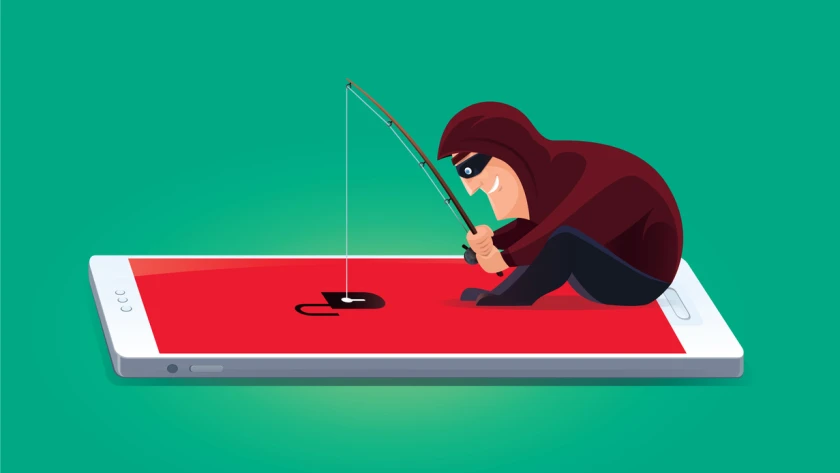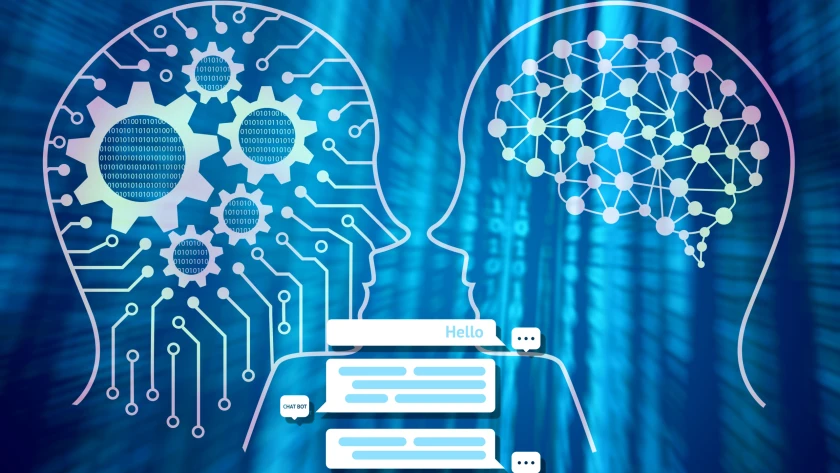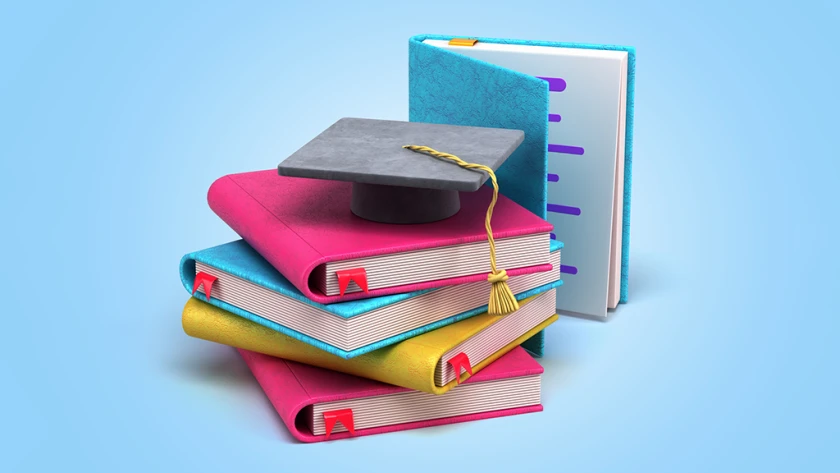Qualität durch Präzision
Anhand dieser vier Beispiele wird deutlich, dass ein KI-System einen passgenauen Text verfassen kann, wenn es dazu aufgefordert wird. Im Vergleich der verschiedenen Prompts zum selben Themenbereich ist außerdem erkennbar, dass die Qualität des Textes maßgeblich auch davon abhängt, wie spezifisch die Angaben im Prompt waren. Die Frage „Wer ist Goethe?” (Beispiel 1) liefert ein deutlich weniger bestimmbares Ergebnis als der Prompt in Beispiel 2 „Was sollten Schülerinnen und Schüler über Goethe wissen?”. Die besten Ergebnisse – mit jeweils einer unterschiedlichen Zielrichtung – liefern die deutlich präziser formulierten Prompts in den letzten beiden Beispielen.
Aus den Beispielen geht auch hervor, dass ein KI-System dazu in der Lage ist, einen Text durch Absätze, Zwischenüberschriften oder Nummerierungen zu strukturieren. Im Beispiel hätte ein Prompt auch lauten können: „Nenne die drei wichtigsten Fakten, die eine Schülerin oder ein Schüler über Goethe wissen sollte.” In diesem Fall wäre die Strukturierung der Antwort bereits vorgegeben worden. Zudem können Text auch adressatengerecht verfasst werden, was in den Beispielen 3 und 4 deutlich wird.
Allerdings – und das ist ebenfalls eine notwendige Lernerfahrung für Schülerinnen und Schüler – können die Antworten eines KI-Systems bisweilen auch die gegebenen Befehle missachten. So ist der Text in Beispiel 3 etwa länger als gefordert (ca. 2.500 Zeichen statt den geforderten maximal 2.000 Zeichen), in Beispiel 4 wird die geforderte Länge korrekt eingehalten. Üben Sie mit den Lernenden, wie die Gestaltung von Prompts aussehen muss, um zu gewünschten Ergebnissen zu gelangen. Ermutigen Sie die Schülerinnen und Schüler, hier auch das Trial-and-Error-Prinzip auszuprobieren und mit sich mit jeweils leicht abgewandelten Prompts immer stärker an das gewünschte Ergebnis anzunähern.
Die Bedeutung von Prompts lässt sich auch spielerisch erkunden. Eine Anregung dazu möchten wir Ihnen im Folgenden geben.
KI als Jeopardy-Spiel
Kennen Sie die amerikanische Fernsehshow Jeopardy? Bei dieser Spielshow wurde das sonst übliche Prinzip umgedreht: Die Showmaster der Sendung präsentieren Antworten, die Teilnehmenden müssen die entsprechenden Fragen dazu formulieren. Dieses Prinzip könnten Sie sich zunutze machen, um den Schülerinnen und Schülern eine Antwort des KI-Systems zu präsentieren und sie zu fragen, mit welchem Prompt diese Antwort wohl entstanden ist. Und umgekehrt könnten natürlich auch die Schülerinnen und Schüler selbst entsprechende Aufgaben erzeugen. Dazu ist es wichtig, dass die Lernenden zunächst selbst prüfen, ob die Antwort inhaltlich stimmig ist, bevor sie sie weitergeben.