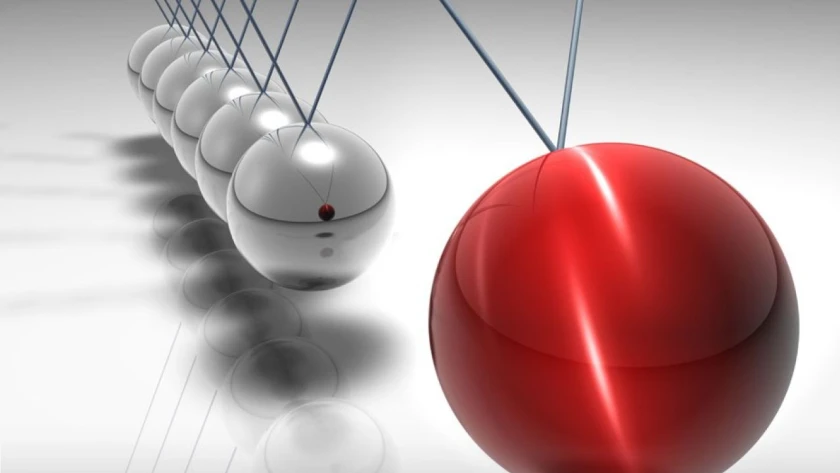Eine transparente Kommunikation vorbereiten

Schulische Veränderungsprozesse basieren auf der Akzeptanz und dem Engagement aller Beteiligten. Wie aber lassen sich Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte und weitere Akteure in- und außerhalb der Schule für den veränderten Unterricht mit mobilen Endgeräten Ausstattung gewinnen? Der vorliegende Artikel beschreibt ausgehend von theoretischen Modellen konkrete Umsetzungsvorschläge, wie die Schulgemeinschaft eingebunden werden kann.
Woran kann man sich orientieren?
Um die Arbeit mit mobilen Endgeräten auf Schulebene erfolgreich zu initiieren, bedarf es eines Führungsstils, der darauf ausgerichtet ist, das Kollegium aufgrund der eigenen Überzeugung, Motivation und Zuversicht mitzunehmen. Für diesen Schritt haben sich die drei folgenden Grundhaltungen für Führungskräfte als sehr bedeutsam herausgestellt:
Führung in diesem Kontext bedeutet, eine grobe Vorstellung/Vision über Unterricht/Schule der Zukunft zu entwickeln. Auf der Basis der zentralen Handlungsfelder und den daraus abgeleiteten Priorisierungen/Zielen kann dann eine gemeinsame Sinnstiftung für den Digitalisierungsprozess im Kollegium geschaffen werden.
Positive Energie entsteht zumeist dann, wenn Menschen Möglichkeiten des Gestaltens haben. Zum einen ist es wichtig, dass Menschen in Entscheidungsprozesse eingebunden und ihre Stimmen und Argumente gehört werden (Involvement). Zum anderen hat sich gezeigt, dass Energie bei Mitarbeitenden dann freigesetzt wird, wenn Verantwortung abgegeben wird (Empowerment).
Ausgehend von den Handlungsfeldern und priorisierten Zielen geht es dabei u. a. darum, die Kräfte zu bündeln und sich auf die Stärken und Potentiale zu fokussieren, die das Kollegium im Kontext der Digitalisierung einbringen kann.
Weiterführende Hintergründe und Informationen zu dieser Thematik finden Sie in den folgenden Angeboten der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP):
Im Hinblick auf die bevorstehenden Neuerungen stehen folgende Überlegungen zu einer klaren und transparenten Kommunikation im Fokus.
Wie werden die geplanten Veränderungen zielführend kommuniziert?
Viele Fragestellungen, z. B. auf der Ebene der Unterrichtsentwicklung, können nicht von der Schulleitung allein, sondern beispielsweise von der Steuergruppe formuliert werden. Eine Beantwortung der aufgeworfenen Fragen sollte dabei unter Einbezug des gesamten Kollegiums bzw. schulischer Gremien erfolgen. Mögliche Handlungsoptionen werden also allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft in geeigneter Form kommuniziert, bevor es zu konkreten Entscheidungen kommt. Auch kritischen Stimmen sollte Raum gegeben werden, damit Vorbehalte in einem offenen Diskurs geklärt und im Idealfall ausgeräumt werden können.
Die Erziehungsberechtigten, das pädagogische Fachpersonal und die Lernenden im Blick
Um die geplante Einführung der veränderten Ausstattung erfolgreich kommunizieren zu können, hilft es, die Sichtweise der Erziehungsberechtigten und der Fachkräfte in der Ganztagsbetreuung und den Schulbegleitern am Vormittag, die mit der anstehenden Veränderung konfrontiert werden, einzunehmen. Diese könnten sich beispielsweise folgende Fragen stellen:
Welche Vorteile entstehen aus der angestrebten Veränderung für die Lernenden?
Was bedeutet die Einführung von mobilen Endgeräten/Tablet-/Laptopklassen konkret für mich?
Wo erhalten wir Unterstützung?
Welche Rahmenbedingungen gelten für die Einführung der mobilen Endgeräte?
Im Hinblick auf die Einbindung in den Veränderungsprozess ergeben sich zwei Kommunikationsebenen:
Reine Information: Die Erziehungsberechtigten, Fachkräfte und Lernenden werden mittels Informationsschreiben, Homepagebeiträgen oder Elterninformationsabenden in Bezug auf Gerätebestellung, veränderten Unterricht und Medienerziehung informiert.
Aktive Beteiligung: Die Erziehungsberechtigten und/oder Lernenden werden unmittelbar in Entscheidungsfragen eingebunden, z. B. im Hinblick auf medienerzieherische Fragen oder Nutzungsregeln. Auf diese Weise werden weitere Potenziale offenkundig, die eine gelingende Erziehungspartnerschaft verbessern können.
In der Praxis greifen diese Ebenen ineinander. Anhand der folgenden Beiträge wird deutlich, dass alle Beteiligten nicht nur zu Beginn, sondern regelmäßig und zu geeigneten Zeitpunkten in den Veränderungsprozess einbezogen werden sollten. Wie unterschiedlich Schulen und Schularten dies umsetzen, erfahren Sie hier:
-
“Die Umsetzung des veränderten Ausstattung erfolgt an unserer Schule in enger Zusammenarbeit dem pädagogischen Fachpersonal. In kurzen Fortbildungen wurde dargestellt, wie man Jugendliche auf ihrem Weg zum verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien begleiten kann. Gemeinsam werden unter anderem medienpädagogische und technische Informationsveranstaltungen für interessierte Eltern geplant und durchgeführt. Der kontinuierliche Austausch über medienerzieherische Fragen ist ein wichtiger Teil unserer Erziehungspartnerschaft.“
(Lehrerin an einer Förderschule)
-
„Zu Beginn des Schuljahres findet bei uns für alle Schulbegleiter eine kurze Einführung statt. Es werden die für alle Klassen geltenden Regeln für digitale Geräte vorgestellt und auf Besonderheiten hingewiesen. Während des Unterrichts erlernen die Schulbegleitungen dann gemeinsam mit den Lernenden die verschiedenen Anwendungen und unterstützen sie gegebenenfalls. Spezielle Fragen beantwortet die Klassenlehrkraft oder die Schulbegleitungen nutzen die Mediensprechstunde der Systembetreuer. Zu speziellen Apps, zum Beispiel zur unterstützten Kommunikation, finden einzelne Fortbildungen statt, die auf die individuellen Bedürfnisse des begleiteten Kindes eingehen.“
(Lehrer an einer Förderschule)
-
„Gemeinsam mit dem Personal des Ganztags haben wir ein Konzept für die Betreuung entwickelt. Wir haben uns bewusst für eine medienfreie Pause entschieden, die alle Beteiligten im Ganztag unterstützen. Damit die Fachkräfte des Ganztags den Lernenden bei den Hausaufgaben helfen können, bekommen sie zu Beginn des Schuljahres eine kurze Einführung in die verwendeten Anwendungen. Regelmäßig finden auch Infoveranstaltungen zu medienpädagogischen Themen statt, da gerade am Nachmittag dadurch häufig Konflikte entstehen. Das Personal der Ganztagsbetreuung hat eine feste Ansprechpartnerin aus dem Lehrerkollegium, die diese Konflikte dann mit Hilfe von älteren Schülern aufarbeitet und präventiv in die Klassen geht.“
(Lehrerin an einem Förderzentrum)
Das Kollegium im Blick
Eine erweiterte Ausstattung mit mobilen Endgeräten löst einen Veränderungsprozess aus, welcher den Unterrichtsalltag nachhaltig prägen kann. Diese Weiterentwicklung der Lernkultur hat daher nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn alle Betroffenen die Neuausrichtung rational und emotional mittragen.
Um die geplante Einführung einer erweiterten Ausstattung erfolgreich kommunizieren zu können, hilft es, die Sichtweise einer Lehrkraft, die mit der anstehenden Veränderung konfrontiert wird, einzunehmen. Diese könnte sich beispielsweise bei der Einführung von mobilen Endgeräten folgende Fragen stellen:
Frage 1: Welche Ziele werden an unserer Schule mit der Einführung verfolgt?
Frage 2: Was wird sich dadurch an unserer Schule verändern?
Frage 3: Wie läuft der Prozess der Einführung der Arbeit mit den mobilen Endgeräten ab?
Frage 4: Wie werden die mobilen Endgeräte den Unterricht und die dafür benötigte Vorbereitung konkret verändern?
Frage 5: Werden die Herausforderungen wahrgenommen und Lösungen dafür entwickelt?
Frage 6: Welche neuen Anforderungen kommen auf mich zu und wo erhalte ich Unterstützung?
Frage 7: Kann ich diese Veränderung aktiv mitgestalten? Wo kann ich mich einbringen?
Frage 8: Wie unterstütze ich die Förderschwerpunkte meiner Schülerinnen und Schüler mit Hilfe der mobilen Endgeräte?
Die Beantwortung dieser Fragestellungen kann Ausgangspunkt für den gemeinsam gestalteten Veränderungsprozess sein. Dazu bietet sich eine Lehrerkonferenz an. Die nachfolgende Präsentation stellt eine mögliche Grundlage für die Gestaltung eines gewinnbringenden Auftakts dar.
Tipp 1: Stärken und Ressourcen erkennen durch Begegnung
Letztlich erfordert die erfolgreiche Implementierung einer erweiterten Ausstattung, dass der oder die Einzelne eine persönliche Entscheidung trifft, sich zu beteiligen und diese Veränderung zu unterstützen. Gelegenheiten des Informationsaustausches sind hierbei förderlich. Dabei können vor allem Impulse von außen einen entscheidenden Schub für die eigene Entwicklung im Kontext Schule geben:
-
„Unsere Nachbarschule arbeitet schon seit zwei Jahren im 1:1-Setting. Bevor wir damit gestartet sind, haben wir eine Kollegin aus dem Nachbarort eingeladen, die uns erzählt hat, wie das Projekt an ihrer Schule umgesetzt wurde. Von diesem Erfahrungsbericht konnten wir sehr profitieren. Kolleginnen und Kollegen konnten offen Fragen stellen und so manche Bedenken wurden im Vorfeld ausgeräumt.“
-
„In meiner ersten Klasse nutze ich einfache und den Kindern meist bekannte Funktionen des iPads, wie das Fotografieren mit der Kamera. Beim Thema Gefühle im Sachunterricht lichten sich die Schüler in Partnerarbeit gegenseitig ab und versuchen mit ihrem Gesichtsausdruck und ihrer Körperhaltung Wut, Trauer, Angst oder Freude darzustellen. Eine direkte Rückmeldung der Klasse gibt es beim Erraten der geknipsten Gefühlsbilder über den Beamer. Als Hausaufgabe erstelle ich gerne mit einem geeignete online-Tool ein Gefühlsquiz mit den Schülerfotos.“
(Medienkoordinator an einer Förderschule)
-
„Vor ein paar Wochen durfte ich bei meiner Kollegin im Sportunterricht hospitieren und konnte so miterleben, wie insbesondere die Kamerafunktion gewinnbringend eingesetzt werden kann. So erhielten die Lernenden die Möglichkeit, ihre Bewegungsabläufe zu filmen und anschließend zu sichten. Durch die damit verbundene visuelle Rückmeldung konnten sie ihre Leistungen unmittelbar optimieren. Das hat mich sehr beeindruckt und motiviert, es selbst auszuprobieren.“
Tipp 2: Einfluss gewähren
Lehrkräfte und weiteres schulisches Personal sollten so früh wie möglich in den Veränderungsprozess mit eingebunden werden. Denn über die Möglichkeit zur Beteiligung entsteht Offenheit gegenüber den geplanten Neuerungen, wobei selbst kritische Beiträge eine wertvolle Ressource darstellen können. Fühlen sich Lehrkräfte in ihrem Anliegen gehört und ernst genommen, entsteht ein konstruktives Teamklima.
-
„Die erste Idee für die geplante Veränderung wurde uns im Rahmen einer Lehrerkonferenz vorgestellt. In den Wochen darauf hatten wir Zeit, in Jahrgangsstufenteams darüber zu diskutieren. So konnte jeder alle Stimmen hören und schließlich sich eine eigene Meinung bilden. Zu einem späteren Zeitpunkt fand eine Abstimmung statt. Das daraus resultierende Stimmungsbild diente der Steuergruppe als Orientierung bei der weiteren Planung. Dadurch wurde jeder ernst genommen und in die Gestaltung mit einbezogen.“
(Lehrerin an einer Förderschule)
-
„Wir haben im Kollegium abgefragt, wo es Unsicherheiten in Bezug auf den Einsatz digitaler Geräte im Unterricht gibt. Anschließend haben wir hierfür gezielte Fortbildungen angeboten, die kompetente Nutzerinnen aus unserem Kollegium gehalten haben. Jede Lehrkraft konnte sich für ein Angebot entscheiden. Für digitale Neulinge hat eine Mitarbeiterin die grundlegenden Funktionen des Tablets für den Einsatz im Unterricht erklärt. Andere waren an bestimmten Programmen zur Erstellung von Arbeitsmaterialien interessiert, haben sich den Einsatz der digitalen Tafel erklären lassen oder nützliche Tools ausgetauscht. Die bedürfnisorientierte Wahl des passenden Angebots hat den Einstieg für alle leichter gemacht.“
(Medienkoordinator an einer Förderschule)
-
„Wir haben den pädagogischen Tag für den Austausch mit dem Kollegium genutzt. Dabei wurden wir bei der Konzeption und Gestaltung des Tages als Steuergruppe von einem externen Referenten aus dem Referentennetzwerk und einer Schulentwicklungsmoderatorin unterstützt. Mithilfe der externen Expertise ist es uns gelungen, sowohl inhaltlich als auch strukturell den Entwicklungsprozess systematischer und transparenter zu gestalten.“
(Mitglied des Medienteams der Förderschule)
Tipp 3: Sinn vermitteln und Bedeutsamkeit des Anliegens sichtbar machen
Wichtig erscheint es, die Selbstverpflichtung zum Wandel regelmäßig zu bekräftigen. Zielsetzungen sollen gelebt werden, indem Anerkennung und Transparenz geschaffen werden. Dadurch wird die Bedeutung des Anliegens unterstrichen.
-
„Es ist uns ein großes Anliegen, dass alle Lehrkräfte die Digitalisierung an unserer Schule als unkompliziert und gewinnbringend für sich erfahren können. Dazu nutzen wir insbesondere Drive über BayernCloudSchule für die Dateienablage, in der das gesamte Kollegium Unterrichtsmaterial austauschen und alle wichtigen Unterlagen der Schule finden kann. Über digitale Pinnwände von Taskcards tauschen wir Ideen aus und arbeiten hier bei Sachunterrichtsthemen klassenübergreifend zusammen. Davon profitiert jeder.”
(Mitglied des Medienkonzeptteams einer Förderschule)
-
„Bei der Kommunikation achten wir darauf, weniger den technischen Aspekt als vielmehr die didaktischen Möglichkeiten in den Fokus zu rücken. Zu viele technische Fachbegriffe und Details zum Gerät verunsichern manche Lehrkräfte und die Erziehungsberechtigten.“
(Mitglied der Steuergruppe eines Förderzentrums)
-
„An unserer Schule wurden Umfragen durchgeführt und die Ergebnisse zeigen, was bereits erreicht wurde, welches Entwicklungspotenzial besteht und wie positiv das Kollegium die Veränderungen erlebt.”
(Lehrer an einer Förderschule)