Schulbeispiel 1 - 1:1 Ausstattung
Ausstattungsgegebenheit
Allen Lernenden steht ein eigenes digitales Endgerät zur Verfügung (1:1-Ausstattung). Die Lernenden arbeiten mit digitalen Endgeräten, die über die Teilnahme vorheriger Schulen an dSdZ beschafft wurden, eigene nutzbare Endgeräte oder diese werden von Ausbildungsbetrieben - auch zum schulischen Gebrauch - zur Verfügung gestellt.
Um in wenigen Einzelfällen das Fehlen von Endgeräten auszugleichen, stehen an der Schule in beschränktem Umfang schulische Geräte zur Verfügung, die von den Lernenden im Unterricht genutzt werden können.
Es kann also davon ausgegangen werden, dass im Unterricht digital gearbeitet werden kann. Somit können die Potenziale digitaler Medien umfassend genutzt werden.
Wie positionieren wir uns als Schule/Fachbereich zum Einsatz schülereigener mobiler Endgeräte im Unterricht?
Der Einsatz geeigneter digitaler Endgeräte und damit die digitale Organisation des Schulalltags ist Standard. Der Unterricht erfolgt in der Regel papierlos und überwiegend digital.
Im Unterricht wird das Arbeiten mit digitalen Endgeräten systematisch angeleitet und gefördert.
Darüber hinaus gibt es Nutzungsregeln, die einen Gebrauch weiterer privater Geräte (z. B. Smartphones) entsprechend regeln.
Welche konkreten Potenziale digitaler Endgeräte für den Unterricht identifizieren wir als strategische Schwerpunkte für unsere Schule und den einzelnen Fachbereich?
-
Veranschaulichung zur Nachvollziehbarkeit des Lernangebotes
Strukturierung der Lehr- und Lerninhalte
Materialien werden immer zentral in der Lernumgebung bereitgestellt, damit auch abwesende Schüler darauf einen Zugriff haben. Lerninhalte können in Form von Kursen (z. B. ein Kurs pro Fach (in der Lernplattform) didaktisch sinnvoll und klar strukturiert werden. Dies hilft insbesondere schwächeren Schülern sehr.
Die Schüler können auch in nachfolgenden Jahrgangsstufen auf das vollständige Material der Vorklassen zugreifen.
Anschauliche Darstellung von Unterrichtsinhalten
Lerninhalte und Lernziele können für die Schüler visualisiert werden. In der Erarbeitungsphase ist es möglich die Inhalte in verschiedenen Formen, z. B. als Text in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, Video oder Hörtext bereitzustellen. Die Schüler können gemäß Vorwissen und persönlicher Vorliebe auswählen, womit sie arbeiten möchten.
Darüber hinaus ist es für die Lehrkraft möglich auch Videos und Simulationen im Unterricht einzusetzen, insbesondere in schülerzentrierten Phasen. Die Schüler können die die Unterrichtsinhalte (z. B. Videos oder Simulationen) im individuellen Lerntempo ansehen.
Ergebnissicherung
Der Unterricht findet papierlos statt, daher werden auch Lösungen und unterschiedliche Handlungsprodukte überwiegend digital zur Verfügung gestellt.
Differenzierungsangebote in Form von Aufgaben und Übungen für leistungsschwache und leistungsstarke Schüler können einfach eingebunden werden.
-
Nachvollziehbarkeit des Lernangebotes durch Veranschaulichung
Materialien werden immer zentral in der Lernumgebung bereitgestellt, damit auch abwesende Schüler darauf einen Zugriff haben. Lerninhalte können in Form von Kursen (z. B. ein Kurs pro Fach (in der Lernplattform) didaktisch sinnvoll und klar strukturiert werden. Dies hilft insbesondere schwächeren Schülern sehr.
Die Schüler können auch in nachfolgenden Jahrgangsstufen auf das vollständige Material der Vorklassen zugreifen.
Lerninhalte und Lernziele können für die Schüler visualisiert werden. In der Erarbeitungsphase ist es möglich die Inhalte in verschiedenen Formen, z. B. als Text in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, Video oder Hörtext bereitzustellen. Die Schüler können gemäß Vorwissen und persönlicher Vorliebe auswählen, womit sie arbeiten möchten.
Darüber hinaus ist es für die Lehrkraft möglich auch Videos und Simulationen im Unterricht einzusetzen, insbesondere in schülerzentrierten Phasen. Die Schüler können die die Unterrichtsinhalte (z. B. Videos oder Simulationen) im individuellen Lerntempo ansehen.
Der Unterricht findet papierlos statt, daher werden auch Lösungen und unterschiedliche Handlungsprodukte überwiegend digital zur Verfügung gestellt.
Differenzierungsangebote in Form von Aufgaben und Übungen für leistungsschwache und leistungsstarke Schüler können einfach eingebunden werden.
-
Lebensweltbezug zur Schülerorientierung
Alltags- und Anwendungsbezug
Die Schüler (insbesondere in kaufmännischen Berufen) müssen im Rahmen ihrer betrieblichen Ausbildung sicher mit digitalen Medien umgehen können. Durch die enge Verzahnung von fachdidaktischen und betrieblichen Inhalten auch im Lehrplan ist die Verwendung von z. B. Office Programmen auch im Schulunterricht notwendig.
Aufgreifen des Mediennutzungsverhaltens
Den Schülern ist der Unterschied zwischen privater und betrieblicher bzw. schulischer Nutzung des Endgerätes klar. Verstöße gegen die unterrichtliche Nutzung werden vorab klar kommuniziert und geahndet. Es ist sinnvoll, wenn sich alle Lehrer auf ein einheitliches und damit für alle transparentes Regelwerk einigen.
-
Methodenvielfalt durch Variation der Lehr- und Lernmethode
Aktive und vertiefte Beschäftigung mit dem Lerninhalt
Durch die digitale Gestaltung von Lernarrangements ergibt sich die Möglichkeit den Unterricht sehr schülerzentriert zu gestalten.
Einsatz fachspezifischer Methoden
Beispiel ergänzen
-
Individualisiertes Lernen zur Berücksichtigung unterschiedlicher Lernvoraussetzungen
Lernstandserfassung und Anpassung des Lernangebotes
Digitale Unterrichtsarrangements bieten die Möglichkeit individuelle Lernstände einfach zu erheben. So kann von der Lehrkraft nachvollzogen werden, ob und in welcher Geschwindigkeit Aufgaben bearbeitet wurde. Auch (benotete) Leistungsstandabfragen können digital erhoben werden, die Schüler bekommen bei automatisierten Erhebungen direktes Feedback.
Lernförderliches Feedback und Unterstützung
Eine Abgabe von Zwischenergebnissen und Endergebnissen kann über die Lernplattform umgesetzt werden, um Feedback effizient zu gestalten. Der Lehrer kann verbal oder schriftlich Rückmeldung zu Arbeitsergebnissen geben.
Aber es besteht ebenfalls die Möglichkeit über z. B. Abfragen auch anonymisiertes Peerfeedback einzufordern.
Unterstützung des selbstgesteuerten Lernens
Durch die Unterrichtsgestaltung in Form von Selbstlernkursen via Lernplattform können Schüler die Kurse komplett selbstgesteuert durchlaufen. Auch leistungsschwächere Schüler werden gut durch die Unterrichtseinheit geführt. Die Organisation mit vielen Zetteln z. B. bei komplexen Lernzirkeln, fällt für Lehrer und Schüler weg. Bei Bedarf können von den Lernenden zusätzliche Informationsangebote wahrgenommen werden, leistungsstarke Schüler können überspringen oder verkürzen. Dies impliziert darüber hinaus, dass die Inhalte im persönlichen Lerntempo bearbeitet werden.
-
Kompetenzorientierte Aufgabenformate und intelligentes Üben zum nachhaltigen Lernen
Medienproduktive und kollaborative Aufgabenformate
Erstellung von Präsentationen unter Einsatz der KI
Präsentationen
Erstellung von Präsentationen, Infografiken, Podcasts oder Erklärvideos zu unterschiedlichen Themen (z. B. Unternehmensformen, Projektarbeit 12. Klasse, Prüfungsvorbereitung)
Unterstützung durch KI-Tools (z. B. Gliederung, Layoutvorschläge, Sprachsynthese), wobei Reflexion über Chancen und Grenzen von KI Teil der Aufgabe ist (z. B. im Deutschunterricht)
Dokumentation des Arbeitsfortschrittes in Form eines Lerntagebuchs, Logbuchs, Kanbanboard…
Auch in Fremdsprache z. B. Englisch möglich
Kollaboration in Echtzeit:
Gruppenarbeiten über kollaborative Cloud-Tools
gemeinsame Projektarbeiten/Gruppenarbeiten (arbeitsgleich oder arbeitsteilig)
Szenarien
z. B. Kundereklamation.
Verschiedene Reaktionen bei Bearbeitung der Reklamationen (gesetzliche Lage vs. kundenfreundliches Verhalten).
-
Kompetenzorientierte Aufgabenformate und intelligentes Üben zum nachhaltigen Lernen
Systematischer Erwerb von Medienkompetenz
Erwerb der Medienkompetenz „Learning by Doing“
Recherchekompetenz:
gezielte Aufträge zur Informationssuche (z. B. Marktanalysen, Unternehmensdaten des Ausbildungsbetriebs, rechtliche Rahmenbedingungen)
Bewertung der Quellen hinsichtlich Seriosität, Aktualität, Interessenlage (Fake-News-Sensibilisierung)
Reflexion über digitale Arbeitswelten:
Diskussion zu Chancen & Risiken digitaler Tools im Büro- und Unternehmensalltag (z. B. Ablenkung durch Social Media, Datenschutz, Homeoffice-Tools)
Szenarien: „Wie verändert KI kaufmännische Berufe?“
Datenschutz und rechtliche Aspekte:
Auseinandersetzung mit DSGVO, Urheberrecht, digitaler Fußspur im Berufsalltag
Praxisnahe Aufgaben: Formulierung einer Datenschutzvereinbarung für Modellunternehmen (Deutschunterricht)
Selbstmanagement & digitale Disziplin:
Reflexion über Ablenkungspotenziale digitaler Medien
Einsatz von Tools zur Fokussierung (z. B. Zeitmanagement-Apps, Pomodoro-Techniken)
Manipulation durch Soziale Medien thematisieren Verlinkung mebis-Magazin
-
Kompetenzorientierte Aufgabenformate und intelligentes Üben zum nachhaltigen Lernen
Intelligentes Üben
Lernplattformen
(z. B.digitale Leistungserhebeungen Apps zur Übung, interaktive Quizes, KI gestützte Programme
automatisiertes Feedback in Echtzeit
individuelle Schwierigkeitsstufen
Digitale Übungsaufgaben
Excel-/Tabellenkalkulationsübungen für Kennzahlenanalysen oder Kostenrechnungen, Inventar bilden
Rechen und Lösungswege von KI oder anderen Programmen abbilden lassen (z. B. Dreisatz)
Verschiedenste Aufgabenformate (MC, offene und geschlossene Fragen etc.)
Gamification: Wettbewerbsformate wie digitale Quizduelle steigern Motivation
Welche technischen und pädagogischen (ggf. organisatorischen) Rahmenbedingungen müssen geschaffen oder angepasst werden, um die geplante digitale Unterrichtsentwicklung erfolgreich umzusetzen?
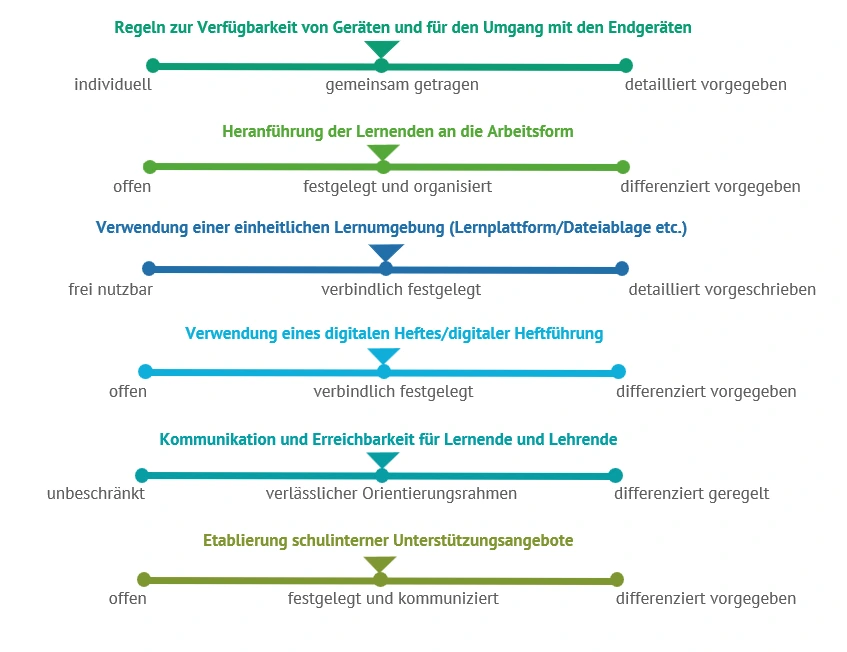
Es gibt Regeln im Umgang mit den privaten mobilen Geräten. Für den Umgang mit den Geräten und die digitale Kommunikation und Erreichbarkeit der Lehrkräfte und Mitschüler wird im Fachbereich eine Art Netiquette erstellt.
Die Unterrichtsmaterialien werden zuverlässig von allen Lehrkräften digital eingestellt. Idealerweise einigt sich ein Lehrerteam auf eine einheitliche Arbeitsstruktur und ein Regelwerk zur Nutzung der digitalen Endgeräte.
Schüler sind altersentsprechend für die Datensicherung und Vollständigkeit ihrer Unterlagen selbstverantwortlich, die Lehrkräfte thematisieren dies und bieten am Anfang Unterstützung.
Datenschutzgrundlagen und das Thema Urheberrecht werden insbesondere in der Eingangsklasse kommuniziert. Die Lehrkräfte achten fortwährend auf die Einhaltung.
Selbst Vorbild bei der Mediennutzung sein, z. B. Lehrerdienstgeräte bei Schülerpräsentationen zuklappen (Hinweis „Sunny side down“), eigene Smartphonenutzung.
Projektionsmöglichkeit und Anbindung an das WLAN für jedes Endgerät, Zugriff auf Drucker und Beamer auch für die Schüler
Einheitliche Lösung zum Datenaustausch ist bereitgestellt.
Zugänge zu schulspezifischen Anwendungen stehen zum Schuljahresanfang bereit.
Es stehen genügend Steckdosen/Lademöglichkeiten bereit, damit die Endgeräte der Schüler den gesamten Schultag verwendet werden können.
Wenige Endgeräte zur Verfügung, damit Schüler diese im Ausnahmefall verwenden können (z. B. technische Probleme, Ladekabel vergessen etc.).
Idealerweise haben die Schüler die Berechtigungen auch Programme auf ihrem Gerät zu installieren. Zum Teil werden die durch den Arbeitgeber bereitgestellten Geräte von diesem gehostet, die Schüler können dann keine Änderungen vornehmen.
Stabile digitale Infrastruktur
Sichere Netze mit Trennung von pädagogischem, Verwaltungs- und Gäste-/Privatnetz
Plattformunabhängige digitale Werkzeuge (Cloudlösungen), sodass alle gängigen Betriebssysteme genutzt werden können.
Welchen konkreten Fortbildungsbedarf für das Kollegium leiten wir aus den definierten Zielen und notwendigen Rahmenbedingungen ab?
Umgang mit der Lernumgebung: Struktur anlegen, Materialien bereitstellen und einsammeln
Lernplattform: Schulungen/Kurse Erstellen mit Unterstützung
Arbeiten im Team in der Klasse/in Parallelklassen
Möglichkeiten der KI im Kontext medienproduktiver Aufgaben reflektieren
Eigene Erklärvideos im Unterricht nutzen
Dienstgerät und digitales Klassenzimmer
Über die reine Unterrichtsentwicklung hinaus: Welche weiteren Potenziale digitaler Medien in den fünf Handlungsfeldern der digitalen Schulentwicklung möchten wir in einem ganzheitlichen Schulentwicklungsprozess strategisch in den Blick nehmen und erschließen?
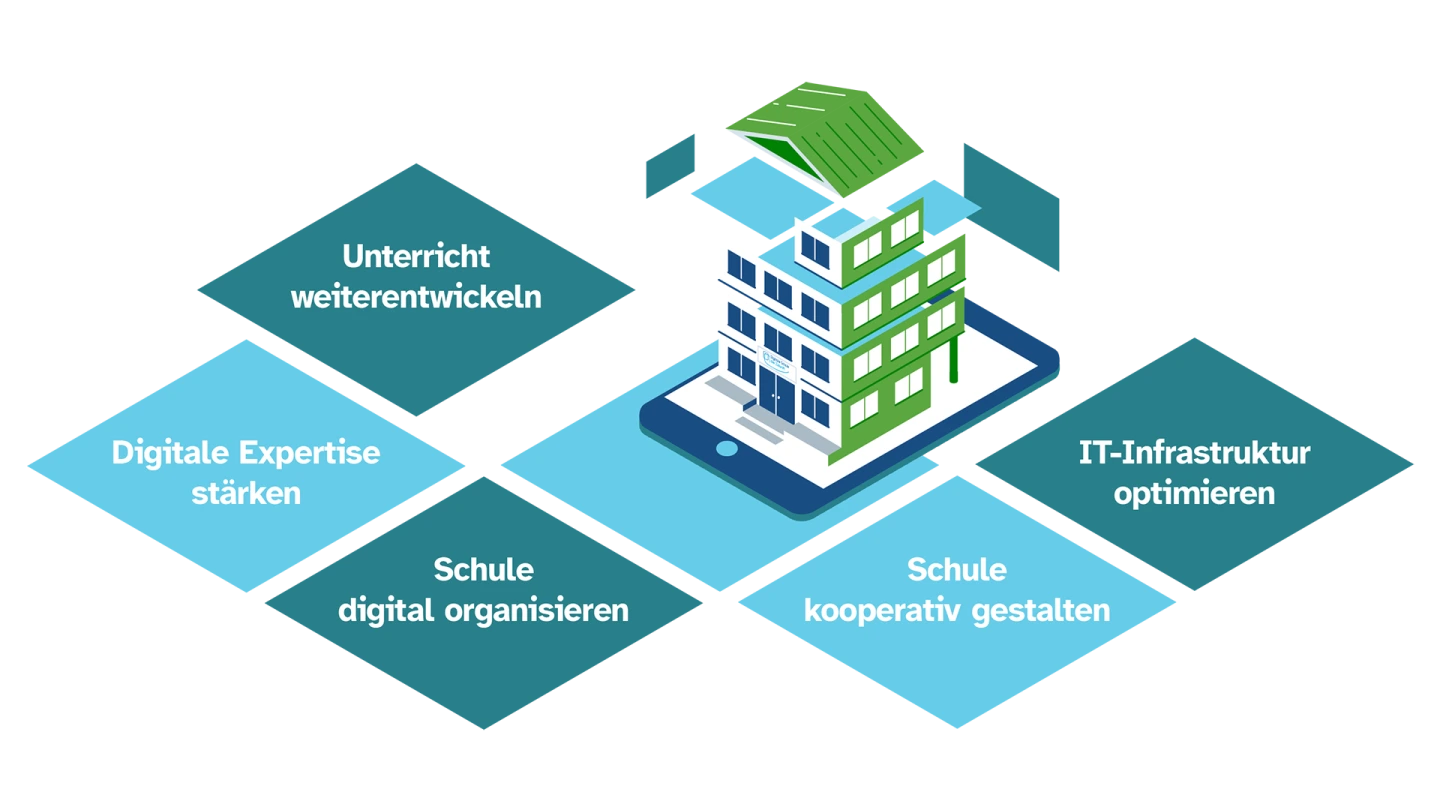
Austausch und Abstimmung mit Ausbildungsbetrieben bezüglich Ausstattung
Bildung von Teams, die sich untereinander abstimmen, z. B. bei der Strukturierung von Kursen und Lernmaterialien. Auch bei der gemeinsamen Unterrichtserstellung und Erstellung von Materialien zur Prüfungsvorbereitung arbeiten Teams zusammen und nutzen Synergien.
Hilfreich sind gemeinsame „Teamstunden“, die im Stundenplan hinterlegt sind. Dies kann zur gemeinsamen Abstimmung und Ausarbeitung von Unterricht genutzt werden.
Es wird genügend Zeit für die Umstellung von analog auf digital gegeben. Digitalisierung wird als fortwährender Prozess gesehen.
Aktive und strukturelle Stärkung von Teamwork durch Schulleitung und Fachbetreuung
Unterstützung von Teamteaching durch Tandems, in denen sich eine Lehrkraft inhaltlich auf den Unterricht konzentrieren kann. Die andere Lehrkraft kann (gerade bei großen Klassen) ein Auge auf den Einsatz der digitalen Endgeräte haben und z. B. bei technischen Problemen helfen. Die Rollen können jederzeit wechseln.
Optimalerweise ist eine Lehrkraft mit IT-Background im Lehrerteam, um technische Probleme zeitnah und unkompliziert zu lösen.